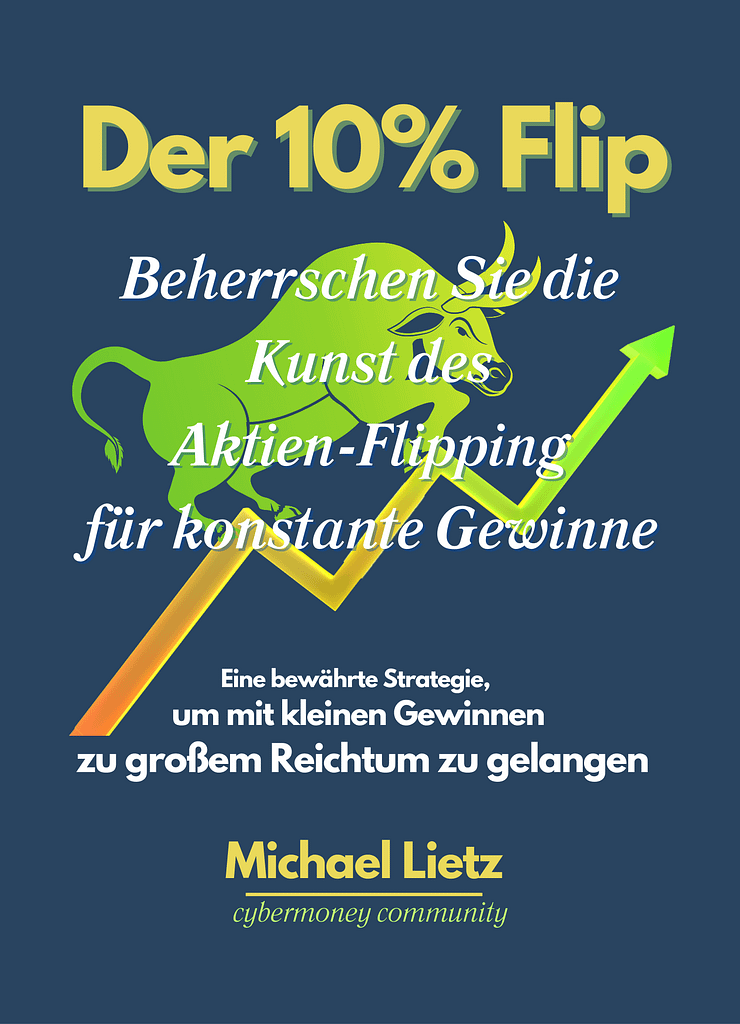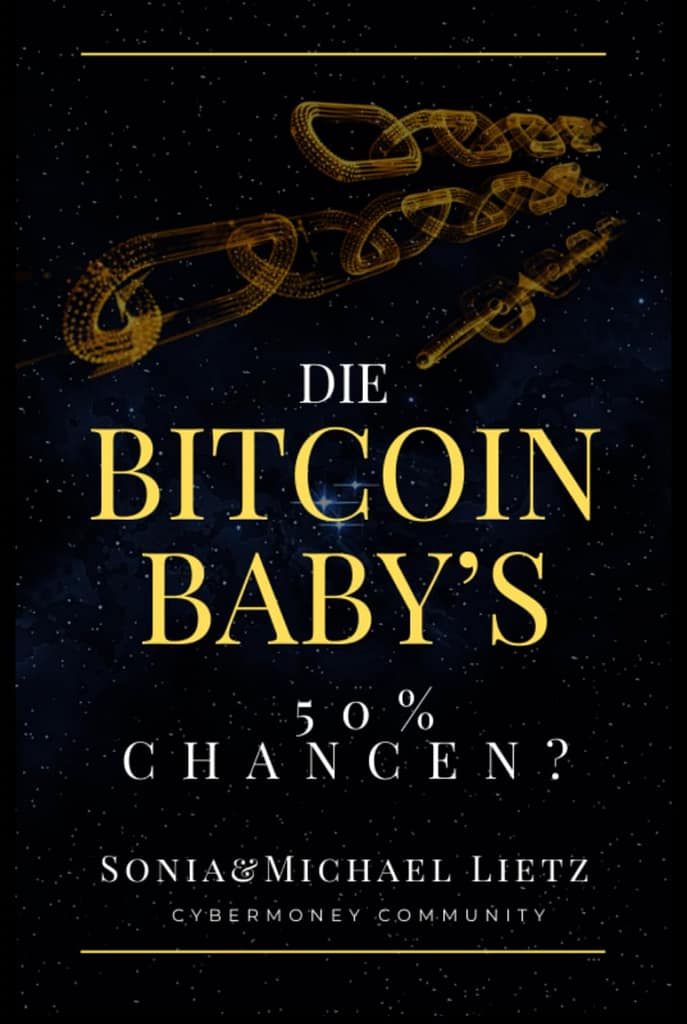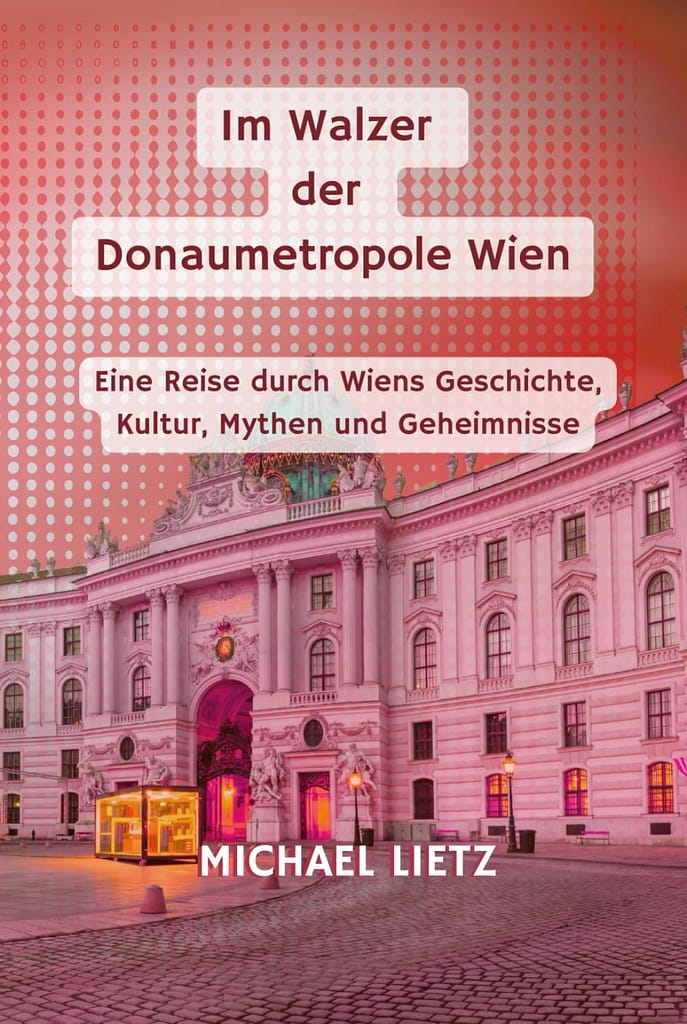Stell dir vor, du schreitest durch das prunkvolle Kirchenschiff des Stephansdoms, das Licht tanzt über Marmor, Glas und Gold – und doch blickst du nur flüchtig hinauf. Doch unter dir, still und unscheinbar, ruht ein Reich, das mehr erzählt als alle Altäre, Orgeln und Türme zusammen. Unter dem Hauptaltar liegt nicht nur Erde, sondern die Relikte hunderter, vielleicht sogar tausender Generationen. In der Tiefe verbirgt sich ein Beinhaus – ein labyrinthartiges Beinhaussystem, in dem die sterblichen Überreste von mehr als zehn tausend Wienern schlummern.
Die Geschichte beginnt nicht im Glanz, sondern im Makabren. Seit Jahrhunderten war der Dom von einem Friedhof umgeben. Die Toten lagen dicht an dicht. Bis ins späte 18. Jahrhundert hinein wurden sie rund um den Dom begraben. Doch Pest, Platzmangel und städtische Hygiene zwangen die Stadt, den Friedhof aufzugeben. Die Gebeine wurden in die Tiefen verlegt – in die Katakomben unter dem Dom, in Grabkammern und schmale Kammern, in denen Knochen neu geordnet wurden.
Das Ergebnis ist eine Stille, die kaum Worte braucht. Wer über die schmale Treppe im Seitenschiff hinabsteigt, verlässt die Welt der Lebenden und betritt einen Raum, in dem die Toten dicht gedrängt liegen – auf mehreren Etagen, Schädel zwischen Schienbeinen, Schulterblätter wie steinernes Geflecht. Man muss keine lebendige Stimme, keinen Text lesen – allein das Wissen, dass hier die Menschen ruhen, die einst die Stadt plärrend und handelnd belebt haben, reicht aus, um Ehrfurcht zu wecken.
Mit Aktien zusätzlich Geld verdienen? Das Buch begleitet deinen Erfolg!
Erinnerungen sprechen durch die Knochenschichten. Da sind Gebeine, exhumiert im Jahr 1735, als die Pest grassierte. Da sind Überreste aus einfachen Gräbern, aber auch die verstärkten Urnen der Habsburger, die ihre Eingeweide hier ließen, während ihre sterblichen Überreste andernorts ruhen. Und da sind die Särge der Bischöfe und Domherren, kunstvoll versiegelt und doch Teil dieses Memento mori‑Reichs.
Das unvollendete Ordnungswerk der Zeit erinnert an menschliche Mühe und Scheitern. Gefangene mussten damals die verrottenden Leichname zerbrechen, Schädel sortieren, Knochen stapeln – bis hinauf an die Decke. Doch manchen Winkel ließ man unvollendet zurück. Chaos und Ordnung kämpfen hier Seite an Seite. Manche Bereiche wirken wie Kunstflächen aus Gebeinen, andere wie Schlachtfelder der Geschichte.
Und dann steigt man wieder hinauf – ins Licht, durch das Hauptschiff, wo das Gold der Kanzel glänzt und das Entzücken der Touristen sich wie ein Hallenlied erhebt. Die Kühle der Katakomben klingt nach im Kopf. Der Knall von feierlichem Orgelspiel fühlt sich ferngerückt an. Du bist nicht mehr nur Beobachter. Du hast nicht nur gesehen. Du spürtest das Fundament der Stadt – in den Knochen derer, die sie erbauten.
Für Städtereisende ist der Abstieg in diese Tiefen ein Geheimnis – ein Erlebnis, das sie nur selten teilen und doch ewig tragen. Für Einheimische, die glauben, ihre Stadt zu kennen, wird der Dom zum Ort der Demut – Ort, wo die Grenze zwischen Stein und Fleisch, Erinnerung und Vergessen, ganz konkret wird.
Denn der Stephansdom erzählt oberhalb Geschichten von Heiligen, Königen und Kunst. Doch unter dem Altar spricht eine andere Stimme: die der Vielen, die gelebt, geliebt und geendet haben – und deren letzte Zeilen aus Knochen bestehen. Wer diese Knochen kennt, wer sie betritt, verlässt den Dom als Zeuge. Und Wien fühlt sich anders an: nicht nur prachtvoll, sondern auch verwoben mit der Ewigkeit.