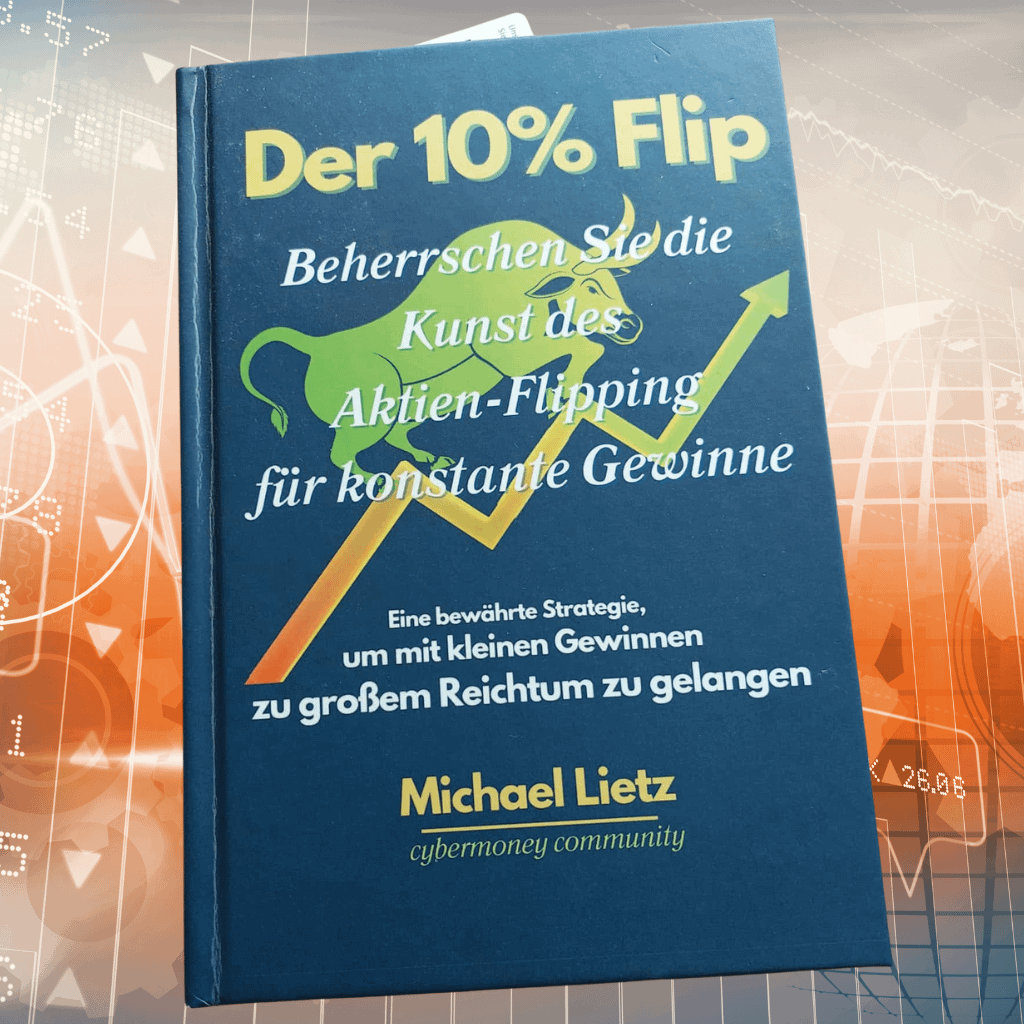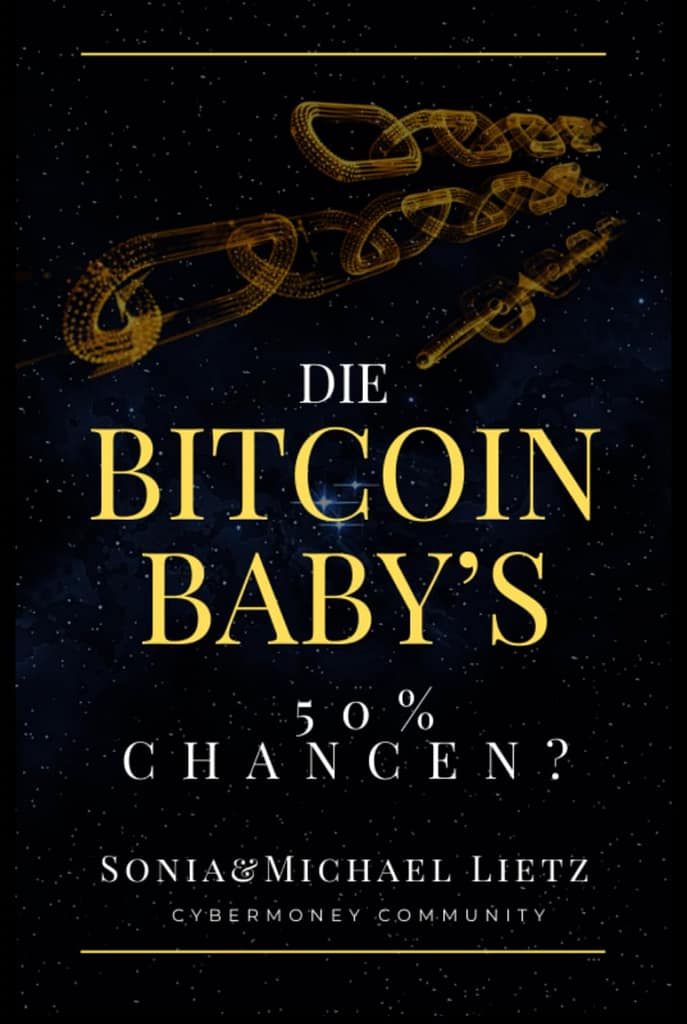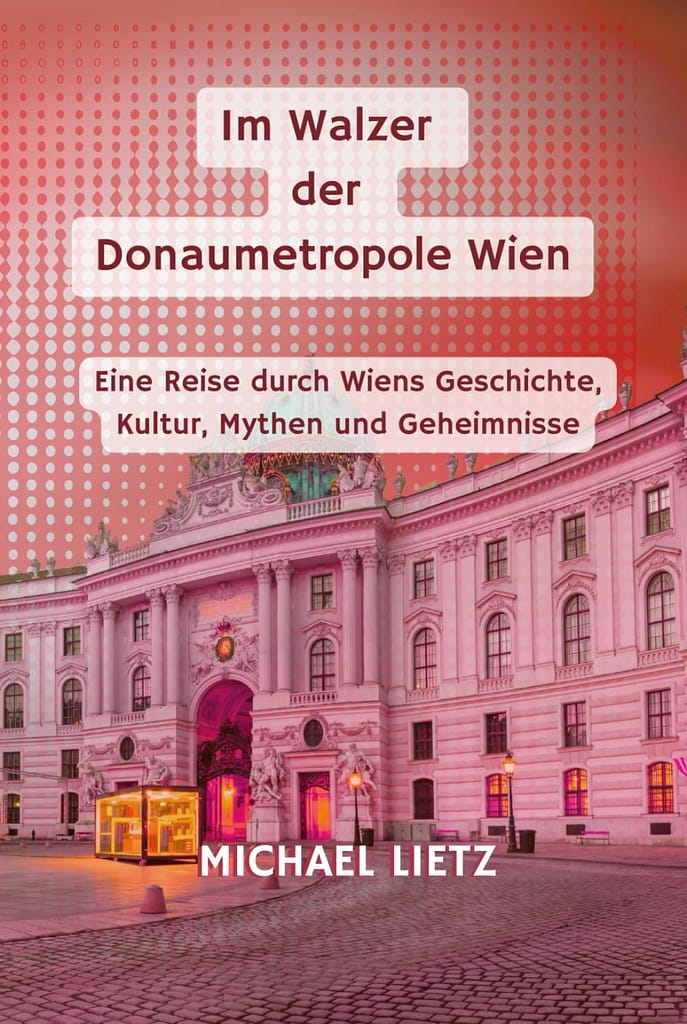Im Jahr 1107, als die Welt noch von Rittern, Kriegen und kaiserlichen Intrigen geprägt war, erblickte ein Mann das Licht der Welt, der die Geschicke eines Landes für immer verändern sollte: Heinrich II., später genannt Jasomirgott. Geboren als zweiter Sohn des heiligen Markgrafen Leopold III. und der mächtigen Salierin Agnes von Waiblingen, floss in seinen Adern das Blut der Kaiser und der unerschütterliche Wille der Babenberger. Seine Geschichte ist nicht nur die eines Herrschers, sondern die eines Visionärs, der Wien aus dem Schatten erhob und Österreich eine Seele gab. Doch hinter dem Mann, der Throne und Titel trug, verbirgt sich ein Geheimnis, das bis heute die Fantasie beflügelt – ein Beiname, dessen Ursprung in den Nebeln eines Kreuzzugs verloren liegt.
Heinrichs Leben begann in einer Zeit, in der Machtkämpfe und dynastische Rivalitäten das Heilige Römische Reich durchzogen. Als Sohn der einflussreichen Agnes, Schwester des letzten Salierkaisers Heinrich V., und Halbbruder des Stauferkönigs Konrad III., war er von Geburt an in ein Netz aus politischen Intrigen und familialen Verpflichtungen verstrickt. Doch Heinrich war kein Mann, der sich von den Fäden anderer lenken ließ. Sein Weg führte ihn zunächst an den Rhein, wo er 1140 zum Pfalzgrafen ernannt wurde. In den fruchtbaren Tälern rund um Heidelberg verwaltete er die salischen Erbgüter seiner Mutter, eine Aufgabe, die ihm zwar Ansehen, aber wenig Ruhm einbrachte. Es war ein Provisorium, ein Sprungbrett, das ihn auf Größeres vorbereiten sollte.
Mit Aktien Geld verdienen? Das Buch an deiner Seite!
Klick auf das Buchcover
Der Wendepunkt kam 1141, als sein jüngerer Bruder Leopold IV. kinderlos starb. Plötzlich fielen Heinrich die Markgrafschaft Österreich und das Herzogtum Bayern in den Schoß. Der junge Babenberger, kaum dreißig Jahre alt, stand nun an der Spitze zweier mächtiger Territorien. Doch Bayern, ein Land voller stolzer Adeliger und welfischer Ansprüche, war ein unruhiges Erbe. Um seinen Anspruch zu festigen, heiratete er 1142 Gertrud, die Witwe des Welfenherzogs Heinrich des Stolzen und Tochter Kaiser Lothars III. Die Hochzeit, ein politisches Meisterwerk, sollte die Fehde zwischen Staufern und Welfen besänftigen. Doch Gertrud, so schön wie ehrgeizig, starb bereits ein Jahr später im Kindbett, und mit ihr zerfiel die Hoffnung auf eine dauerhafte Versöhnung. Heinrich stand allein in einem Sturm aus Rivalitäten und Kriegen.
Der Zweite Kreuzzug von 1147 war ein weiterer Prüfstein für den Herzog. An der Seite seines Neffen, des späteren Kaisers Friedrich Barbarossa, zog Heinrich in den Orient, doch das Unternehmen endete in einer Katastrophe am Fluss Tembris in Kleinasien. Nur durch Glück und schnelle Flucht entkam er dem Tod. In Byzanz, am Hof des Kaisers Manuel I., begegnete er Theodora Komnena, einer jungen Frau von betörender Schönheit und kaiserlichem Blut. 1148 heiratete er sie, eine Verbindung, die den Babenbergern unvergleichliches Prestige einbrachte. Theodora, die Nichte des byzantinischen Kaisers, brachte nicht nur Glanz, sondern auch einen Hauch orientalischer Mystik in Heinrichs Leben. War es in diesen fernen Landen, inmitten der Kreuzzugswirren, dass der rätselhafte Beiname „Jasomirgott“ geboren wurde? Manche sagen, es sei die Verballhornung eines arabischen Spruchs, den Heinrich auf dem Kreuzzug hörte, andere deuten ihn als mittelhochdeutsches „Ja, so mir Gott helfe“. Die Wahrheit bleibt ein Geheimnis, ein Flüstern aus einer längst vergangenen Zeit.
Zurück in Europa stand Heinrich vor einer neuen Herausforderung. Kaiser Friedrich Barbarossa, sein Neffe, suchte einen Ausgleich mit den Welfen und belehnte 1156 Heinrich den Löwen mit Bayern. Doch Heinrich Jasomirgott war kein Mann, der sich kampflos geschlagen gab. In zähen Verhandlungen erreichte er das „Privilegium minus“, einen historischen Akt, der die Markgrafschaft Österreich zum unabhängigen Herzogtum erhob. Es war der Augenblick, in dem Österreich aus dem Schatten Bayerns trat und eine eigene Identität gewann. Heinrich, nun erster Herzog von Österreich, blickte auf ein Land, das nach Stabilität und Ruhm verlangte.
Wien, damals noch ein bescheidenes Städtchen, wurde zum Mittelpunkt seines Schaffens. Anders als sein Vater, der in Klosterneuburg residierte, erkannte Heinrich das Potenzial dieser Stadt an der Donau. 1145 verlegte er seine Residenz nach Wien, in die neu errichtete Burg am Hof. Unter seiner Herrschaft wuchs Wien zur Hauptstadt heran, überstrahlte Krems, Melk und Klosterneuburg. 1147 wurde der Stephansdom vollendet, ein mächtiges Symbol für die aufstrebende Macht der Babenberger.
Heinrichs Vision war klar: Wien sollte nicht nur eine Stadt, sondern das Herz eines neuen Herzogtums werden. 1155 gründete er das Schottenstift, ein Kloster, das mit irischen Mönchen aus Regensburg besiedelt wurde und bald ein Zentrum von Kunst und Gelehrsamkeit wurde. Seine Mauern, in denen heute noch eine Statue Heinrichs steht, zeugen von seinem Erbe.
Doch Heinrichs Regentschaft war nicht ohne Schatten. Kriege mit Ungarn und Böhmen prägten seine Zeit. 1146 erlitt er an der Leitha eine schwere Niederlage gegen König Géza II., und 1176 führte ein Feldzug gegen Böhmen zu seinem tragischen Ende. Auf einer morschen Brücke bei Melk stürzte sein Pferd, und Heinrich erlitt einen offenen Schenkelbruch. Wochen später, am 13. Januar 1177, erlag er seinen Verletzungen in Wien. Sein Leichnam fand im Schottenstift seine letzte Ruhe, neben Theodora und ihrer Tochter Agnes, in einem neuromanischen Sarkophag, der bis heute die Erinnerung an den großen Babenberger bewahrt.
Heinrichs Leben war ein Tanz auf dem schmalen Grat zwischen Macht und Niederlage, zwischen Vision und Tragödie. Er war ein Mann, der mit kluger Heiratspolitik, unermüdlichem Einsatz und einem untrüglichen Gespür für die Zukunft Österreich formte. Wien verdankt ihm seine Stellung als Hauptstadt, Österreich seine Eigenständigkeit. Doch das Geheimnis seines Beinamens „Jasomirgott“ bleibt ungelüftet, ein letzter Funke Mystik, der diesen Mann umgibt. War es ein Schwur, ein orientalisch gefärbtes Echo oder ein spöttischer Spitzname seiner Feinde? Vielleicht war es all das – oder etwas ganz anderes. Heinrich II. Jasomirgott, der Löwe von Wien, lebt in den Gassen der Stadt und den Annalen der Geschichte weiter, ein Mann, dessen Erbe die Zeiten überdauert.
Sichtbarkeit? Du bist Wiener – eine Person des öffentlichen Lebens, der Politik oder Unternehmer, Freiberufler – eben eine echte Wiener Persönlichkeit – Deine Geschichte und dein Video im Stadtmagazin und auf Social Media –> hier klicken