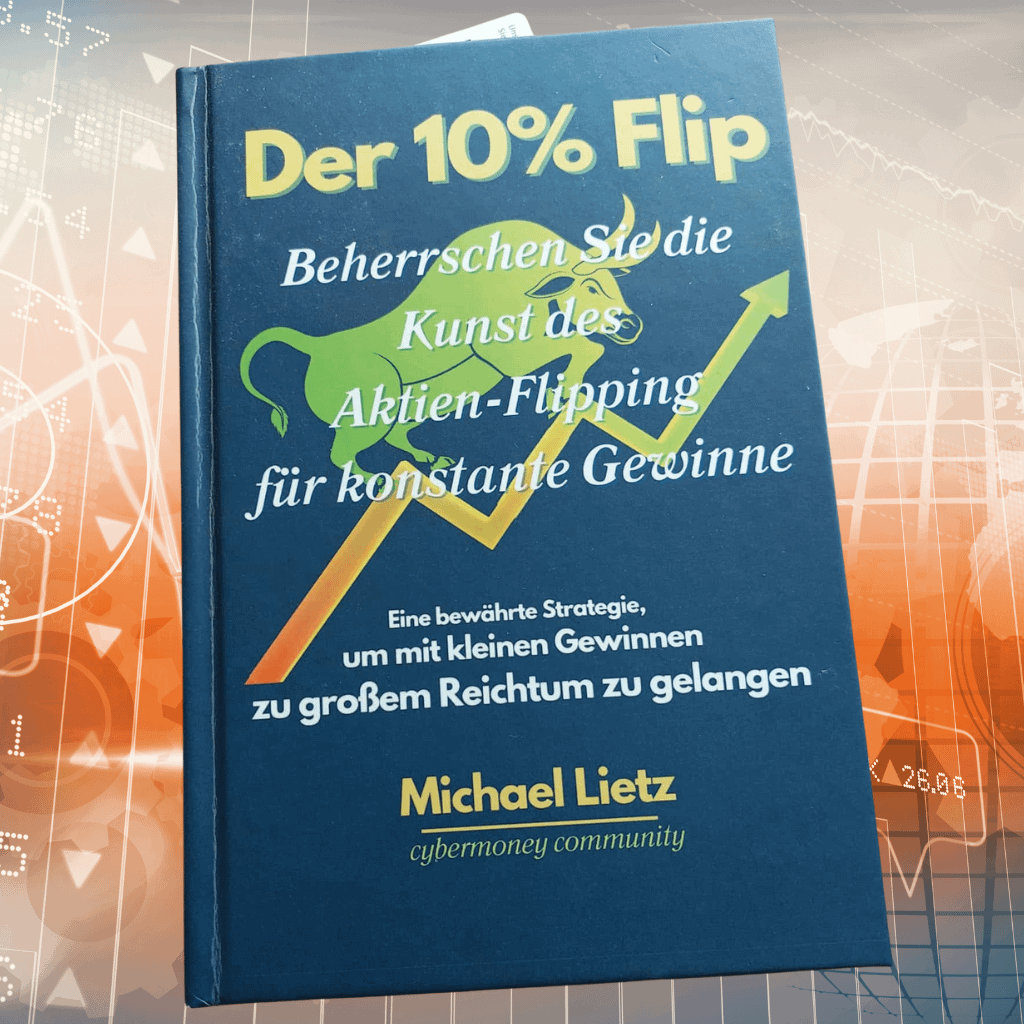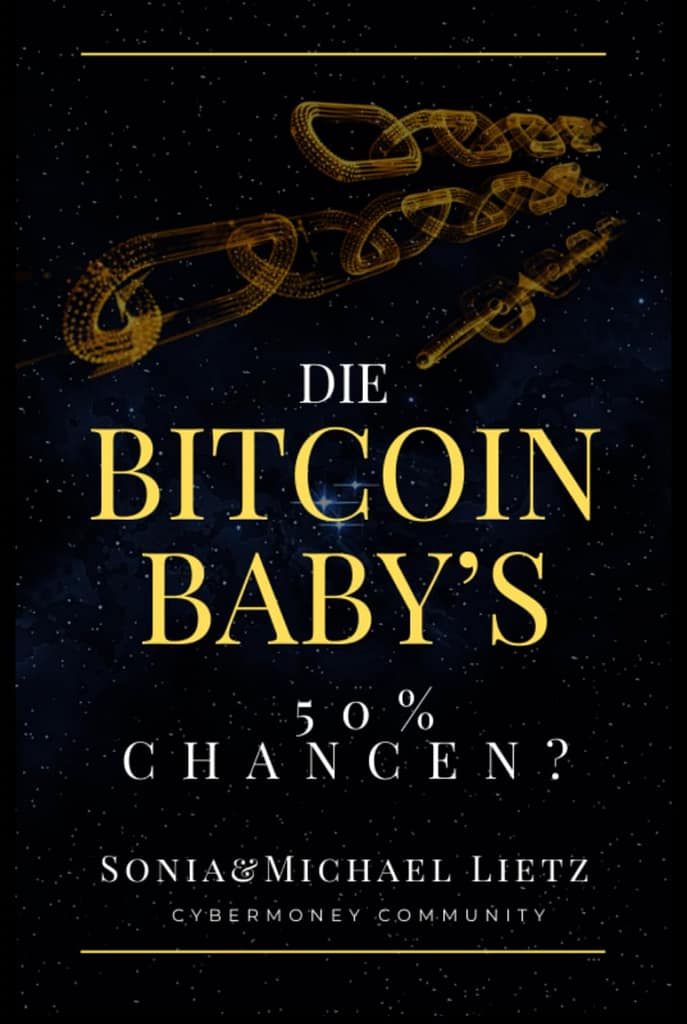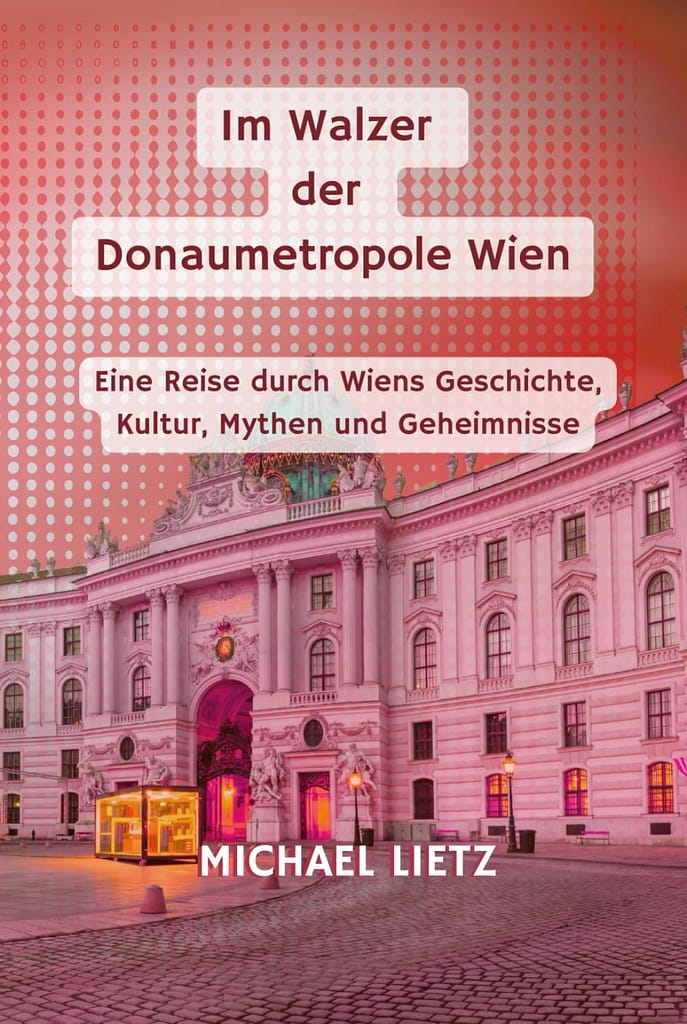In den verwinkelten Gassen von Wien, wo die Donau leise flüstert und die Geschichte in jedem Pflasterstein lebt, wurde am 19. Februar 1957 ein Junge geboren, der die Welt als Falco kennenlernen sollte. Johann „Hans“ Hölzel, der einzige Überlebende einer Drillingsgeburt, kam in den bescheidenen Verhältnissen des Arbeiterbezirks Margaretens zur Welt. Seine Mutter Maria, eine Frau mit unerschütterlichem Glauben an ihren Sohn, und sein Vater Alois, ein Werkmeister, der früh die Familie verließ, prägten eine Kindheit voller Musik und Sehnsucht. Schon als Kleinkind zeigte Hans ein absolutes Gehör, ein Geschenk, das ihn dazu trieb, Schlager aus dem Radio nachzusingen und mit vier Jahren am Klavier zu zaubern. Doch hinter dem strahlenden Stern, der Falco wurde, verbarg sich ein Geheimnis – eine dunkle Vorahnung, die seine Texte durchzog und sein Leben wie ein Schatten begleitete.
Falco war kein Mann für Konventionen. Mit 16 Jahren warf er das Gymnasium hin, brach eine Leh as Bürokaufmann ab und verließ sogar das Wiener Musikkonservatorium nach nur einem Semester. Sein Herz schlug für die Musik, für die rohe Energie der Wiener Underground-Szene, die in den späten 1970er Jahren erwachte. In den verrauchten Clubs von Neubau und den avantgardistischen Kreisen des Ersten Wiener Musiktheaters, später Hallucination Company, fand er seine Bühne. Als Bassist der anarchischen Schock-Rock-Band Drahdiwaberl, wo er seine Designerkleidung mit Plastiküberzügen vor der Chaotik der Auftritte schützte, trat er erstmals als Falco auf – ein Name, inspiriert vom DDR-Skispringer Falko Weißpflog, leicht abgewandelt für den internationalen Glanz. Sein Lied „Ganz Wien“, ein düsterer Pausenfüller über die Drogenszene der Stadt, wurde 1980 zum Underground-Hit, obwohl der Rundfunk es boykottierte. Es war der erste Funke eines Feuers, das bald die Welt erhellen sollte.
Jetzt Geld mit Aktien verdienen – Dein Begleiter – dein Buch:
Wien war Falcos Muse und sein Schlachtfeld. Die Stadt, damals noch im Dornröschenschlaf des Nachkriegs, bot ihm die Bühne für seine Kunstfigur: ein geschniegelter Dandy mit gegeltem Haar, schwarzer Sonnenbrille und Maßanzug, der mit Wiener Schmäh und globalem Ehrgeiz die Grenzen des Austropop sprengte. 1982 erschien sein Debütalbum „Einzelhaft“, und mit „Der Kommissar“ schuf er etwas, das die Musikwelt noch nicht kannte: einen deutschsprachigen Rap, der Europa eroberte und Falco als Pionier des Genres etablierte. Sein Stil, eine Mischung aus New Wave, Funk und David Bowies Berlin-Trilogie, war kühn und neu. Doch es war 1985, als Falco mit „Rock Me Amadeus“ die Welt in Ekstase versetzte. Drei Wochen lang stand der Song an der Spitze der US-Billboard-Charts – ein Kunststück, das kein deutschsprachiger Künstler je wiederholte. Wien, seine Heimat, feierte ihn als Helden, doch die Stadt, die ihn gebar, war auch sein Richter. Die Kontroverse um „Jeanny“, ein Lied, das einen Sexualmord andeutete, spaltete die Gemüter, machte ihn aber nur noch größer.
Falcos Leben war ein Tanz auf dem Vulkan. Seine Wohnung in der Ziegelofengasse, wo er von 1974 bis 1982 lebte, war sein Rückzugsort, das „Alte Fassl“ sein zweites Zuhause. Später, in einer größeren Wohnung in Neubau, baute er ein schalldichtes Studio, wo er nächtelang an seiner Musik feilte. Er war ein Nachbar, der mit einem freundlichen „Hallo, wie geht’s?“ grüßte, doch seine exzentrische Seele lebte in einer anderen Welt. Seine Ehe mit Isabella Vitkovic, die 1988 geschlossen wurde, war ein Sturm aus Liebe und Hass, zerbrochen durch die Enthüllung, dass ihre Tochter Katharina nicht seine leibliche war. Alkohol und Drogen wurden seine Begleiter, als der Druck des Ruhms ihn zu ersticken drohte. Nach dem Höhepunkt von „Falco 3“ und der Welttournee für „Emotional“ ebbte sein Stern in den späten 1980er Jahren ab. Alben wie „Wiener Blut“ und „Data de Groove“ fanden weniger Widerhall, doch Falco gab nicht auf. 1992 meldete er sich mit „Nachtflug“ zurück, und sein Auftritt vor 150.000 Menschen beim Donauinselfest, trotz eines Gewitters, zeigte, dass der Falke noch fliegen konnte.
In den 1990er Jahren zog Falco sich in die Dominikanische Republik zurück, seine Wahlheimat, wo er an einem Comeback arbeitete. Er war optimistisch, voller Pläne, doch das Schicksal hatte andere Vorstellungen. Am 6. Februar 1998, nur Wochen vor seinem 41. Geburtstag, fuhr er in Puerto Plata mit seinem Mitsubishi Pajero vom Parkplatz einer Disco, als ein Bus ihn erfasste. Mit Alkohol, Kokain und THC im Blut endete sein Leben abrupt. Sein Tod war ein Schock, doch sein Vermächtnis lebte weiter. Das posthum veröffentlichte Album „Out of the Dark (Into the Light)“ wurde ein Riesenerfolg, mit Zeilen wie „Muss ich denn sterben, um zu leben?“, die wie ein prophetisches Requiem klangen. Über 4000 Fans begleiteten seinen Sarg, getragen von den „Outsiders Austria“, zum Wiener Zentralfriedhof, wo er ein Ehrengrab erhielt. Seine Mutter Maria, die ihm ein Leben lang treu war, wurde später neben ihm beigesetzt.
Und hier beginnt das Geheimnis, das Falco umgibt. Sein letzter Song, „Out of the Dark“, scheint mehr als ein Zufall. Die Zeilen, geschrieben Jahre vor seinem Tod, klingen wie ein Abschied, eine mystische Vorahnung seines Endes. Manche flüstern, Falco habe seinen Tod geahnt, vielleicht sogar gesucht, getrieben von einer tiefen Todessehnsucht, die in seinen Texten widerhallt. Wiener Dompfarrer Toni Faber sprach von mystischen Elementen in Falcos Musik, von einer Suche nach Gott, die seine Seele durchzog. War es Zufall, dass er in Interviews von einem frühen Tod wie James Dean sprach? Oder hatte Falco, der immer zwischen Größenwahn und Selbstzweifeln schwankte, einen Pakt mit dem Schicksal geschlossen? Dieses Rätsel, gepaart mit seiner charismatischen Exzentrik, macht ihn zur Legende.
Falco war Wiens größter Popstar, ein Mann, der die Stadt mit seinem Wiener Schmäh und seiner Kunstfigur in die Welt trug. Seine Texte, eine Poesie aus Hochdeutsch, Wiener Dialekt und fremden Sprachen, beeinflussen bis heute Künstler wie Bilderbuch oder Wanda. Er war der Falke, der über Wien flog, ein Provokateur, der die Welt eroberte und doch in der Einsamkeit kämpfte. Sein Grab, ein roter Obelisk auf dem Zentralfriedhof, ist eine Pilgerstätte, sein Name ein Synonym für den unsterblichen Geist der Stadt. Falco lebt – in den Liedern, die noch immer klingen, und in den Herzen, die er mit seinem Lachen und seinen Tränen berührte.
Sichtbarkeit? Du bist Wiener – eine Person des öffentlichen Lebens, der Politik oder Unternehmer, Freiberufler – eben eine echte Wiener Persönlichkeit – Deine Geschichte und dein Video im Stadtmagazin und auf Social Media –> hier klicken