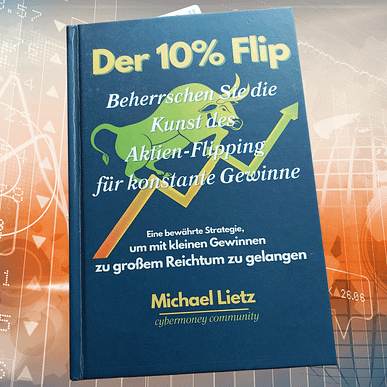Es gibt Künstler, deren Werke leuchten wie ein funkelnder Stern, und es gibt solche, die brennen wie ein Feuer, das alles verzehrt. Egon Schiele war Letzteres. Wien, die Stadt der Kaiser, der Musik und der goldenen Ornamentik, erhielt durch ihn eine Stimme, die nicht in Tönen und Melodien erklang, sondern in Linien, die schnitten wie ein Messer, in Farben, die nicht beschönigten, sondern offenlegten.
Geboren 1890 in Tulln an der Donau, fand Schiele schon früh zur Kunst. Mit sechzehn Jahren trat er in die Akademie der bildenden Künste in Wien ein – ein Ort, an dem er bald aneckte. Zu streng, zu starr erschien ihm das, was dort gelehrt wurde. Er wollte tiefer, er wollte den Menschen nicht als Ideal, sondern in seiner Zerbrechlichkeit zeigen. Gustav Klimt, damals bereits der gefeierte Meister des Wiener Jugendstils, wurde zu seinem Mentor. Klimt schenkte ihm nicht nur Anerkennung, sondern auch Zutritt zu Kreisen, in denen sich Wien von seiner modernsten Seite zeigte. Doch während Klimt golden schmückte, entblößte Schiele.
Seine Werke waren eine Provokation, doch sie waren auch von einer Wahrheit, die man nicht ignorieren konnte. „Tod und Mädchen“, gemalt 1915, zeigt Schiele selbst mit seiner Geliebten Wally Neuzil – ein Bild, das Liebe, Vergänglichkeit und den unausweichlichen Tod in einem Moment einfängt. Die Figuren umschlingen sich, doch sie halten sich nicht wirklich fest. Es ist eine Umarmung im Wissen, dass alles brüchig ist. Dieses Gemälde wurde zu einem Sinnbild seiner Kunst: intensiv, ungeschönt, zutiefst menschlich.
Auch „Die Familie“, eines seiner letzten Werke, gemalt kurz vor seinem Tod 1918, berührt bis heute. Schiele malte sich selbst, seine Frau Edith und das ungeborene Kind, das sie erwarteten. Doch das Bild blieb unvollendet, so wie ihr gemeinsames Leben, das die Spanische Grippe grausam beendete. Edith starb im sechsten Monat schwanger, und nur drei Tage später folgte ihr Egon. Er war erst 28 Jahre alt, doch seine Kunst hatte ihn längst unsterblich gemacht.
Seine Selbstbildnisse sind vielleicht die eindringlichsten Zeugnisse seiner Seele. Schiele malte sich nicht als Held, nicht als strahlenden Künstler, sondern als Fragenden, als Getriebenen, oft nackt, verzerrt, manchmal fast grotesk. In jedem Strich spürt man die Dringlichkeit, die Suche nach Wahrheit, den Kampf mit sich selbst. Kaum ein Künstler hat sich so schonungslos dem eigenen Spiegelbild gestellt wie er.
Wien war in dieser Zeit mehr als Kulisse – es war Bühne und Mitspieler. Die Stadt vibrierte im Übergang von der kaiserlichen Pracht zur Moderne, sie war Heimat der Psychoanalyse Freuds, der Musik Beethovens und Mahlers, und nun auch der Bilder eines Egon Schiele. Seine Kunst passte in dieses Wien, das zwischen Glanz und Abgrund schwankte, das alles hinterfragte und doch an seinen Traditionen festhielt.
Jetzt mit Aktien Geld verdienen ? – Das Buch das es Dir zeigt !
Heute begegnet man Egon Schiele in Wien vor allem im Leopold Museum. Dort hängen Werke wie „Tod und Mädchen“, „Die Familie“ oder seine eindringlichen Akte. Besucher aus aller Welt strömen herbei, um in seinen Bildern etwas zu erkennen, was zeitlos ist: die nackte, unverhüllte Menschlichkeit. Wien wäre ohne Strauß’ Walzer zu leicht, ohne Klimts Gold zu blass – und ohne Schieles Linien zu glatt.
Egon Schiele schenkte Wien eine andere Seite, die oft im Schatten liegt, aber nie vergessen werden darf. Er war das Gewissen einer Stadt, die sich gerne im Glanz sonnt, aber doch weiß, dass Schönheit und Wahrheit nur im Zusammenspiel bestehen können. Seine Kunst ist ein Echo, das bis heute klingt – roh, verstörend, aber unendlich lebendig.