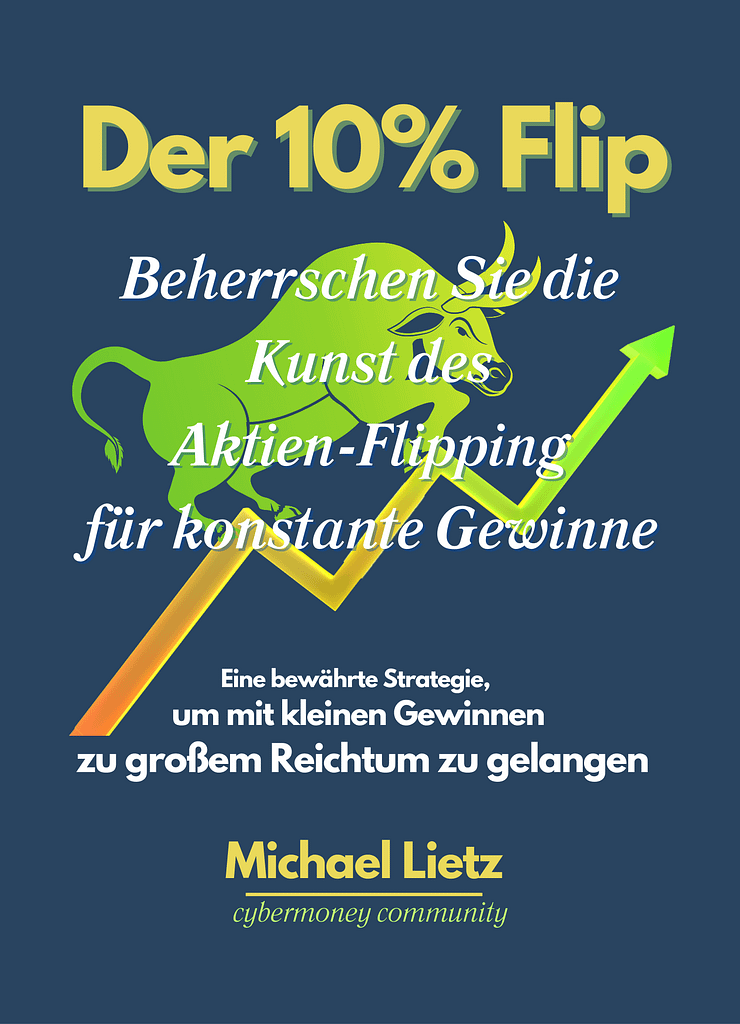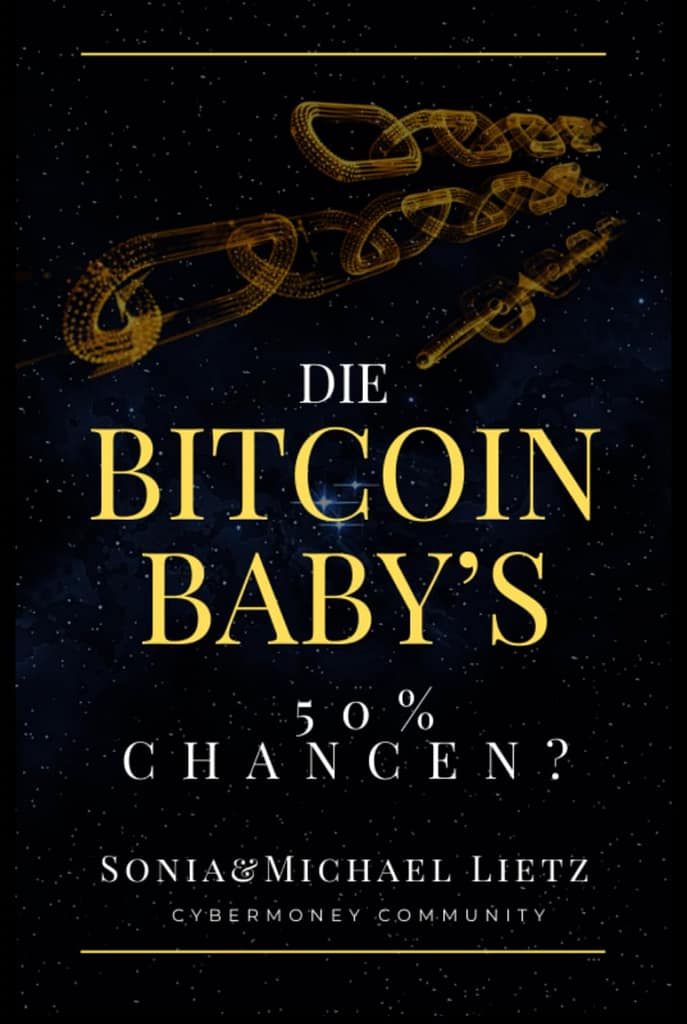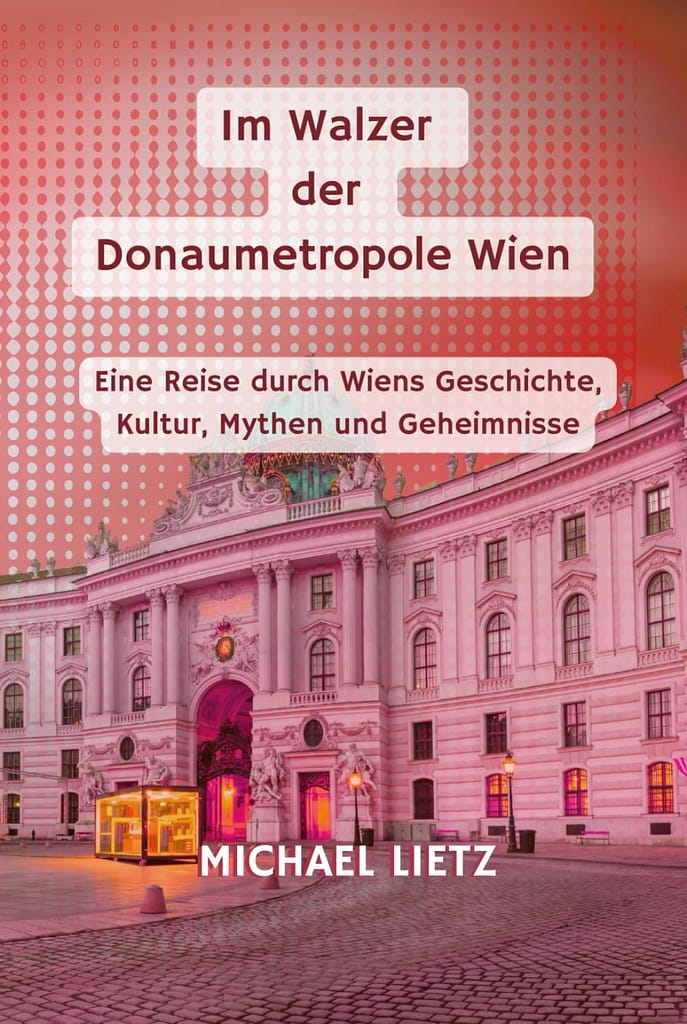Im goldenen Halbdunkel des Stephansdoms erhebt sich eine Kanzel, so kunstvoll wie ein Ausdruck des menschlichen Ehrgeizes. Sie trägt die Zartheit spätgotischer Meisterschaft, und doch spürt man beim Blick nach oben: Etwas fehlt. Der Schalldeckel – jener obere Teil, der die Worte des Predigers über das Gewölbe der Kirche tragen sollte – blieb unvollendet. Der Grund dafür liegt im Verborgenen. Vielleicht verließ der Künstler den Auftrag, vielleicht scheute der Auftraggeber die zusätzliche Last. So ruht die Kanzel heute als Fragment eines Traums, als Zeugnis von Genie und unvollendeter Vision.
Die Kanzel entstand zwischen 1510 und 1515 aus festem Kalksandstein. Jedes Blatt an ihrem Rankenwerk ist so zart gemeißelt, dass man kaum glauben kann, es sei Stein. Die vier Kirchenväter erheben sich im Relief – Augustinus, Gregor, Hieronymus, Ambrosius – nicht nur als Heilige, sondern als Verkörperungen der vier Temperamente. Doch was der Kanzel fehlt, ist der Schutzschirm aus Holz, der die Stimme hätte verstärken und lenken können. Der Schalldeckel blieb aus, und mit ihm ein Plan, der nie Wirklichkeit wurde.
Jetzt in Aktien investieren aber wie? Das Buch zeigt es Dir!
Legenden weben sich um dieses fehlende Stück. Der Künstler, dem man lange Pilgram zuschrieb, verließ Wien bald nach der Ausführung. Andere halten ihn bis heute für verantwortlich, denn an der Kanzel befindet sich sein Steinmetzzeichen – und das Bild eines „Fensterguckers“, eines Meisters, der aus dem Steinfenster blickt. Man munkelt, er habe den Auftrag nicht vollendet, weil ihm der Glanz fehlte, oder der Auftraggeber weigerte sich, mehr zu zahlen. So blieb der Kanzel das Dach versagt – ein Symbol des Unerledigten.
Doch gerade in diesem Unvollkommenen liegt ihre Macht. Sie spricht von Ehrgeiz und Scheitern, von Kunst, die über sich hinauswächst – und von Menschen, die Grenzen nicht überschreiten durften. Wer unter der Kanzel steht und nach oben blickt, spürt den Hauch des Vorhandenen und den Schatten des Fehlenden zugleich. Es ist, als lausche man einer unvollendeten Melodie, deren Töne im Raum verhallen, bevor sie erklingen konnten.
Für Städtereisende offenbart sich hier eine unerwartete Geschichte: Nicht nur Sakralarchitektur, sondern Drama in Stein. Einheimische mögen die Kanzel täglich sehen, doch die Spannung entsteht erst, wenn der Blick nach oben wandert, zum Leerpodest, das nie verhängt wurde. Die Unvollständigkeit verschiebt den Blickwinkel – der Fehler wird zum Geheimnis, der Fehler zur Legende.
Elegant wirkt sie, kraftvoll trotz ihres Mangels. Und in diesem Schweigen über dem Predigtsitz liegt etwas Tieferes: das Wissen, dass selbst das Großartigste unvollendet bleiben kann – ohne an Größe zu verlieren. Die Kanzel ist keine Reliquie. Sie ist ein Denkmal menschlicher Wege, von unvollendeten Worten und verlorenen Tonlagen.
Im Stephansdom wird sie zu einem Dialog zwischen dem Sichtbaren und dem Fehlenden, zwischen Idee und Verwirklichung. Sie vermittelt ein Gefühl für die Zeit, in der sie entstand – eine Zeit, in der Künstler, Baumeister und Auftraggeber aufeinander trafen, und manches Drama in Stein schlummerte. Und wer dieselbe Blickrichtung sucht, findet das Geheimnis in der Leerstelle über dem Geländer, wo ein Schalldeckel hätte sein können. Ein Symbol dafür, dass nicht nur Vollendung glänzt, sondern auch das, was fehlen musste, um Größe zu spiegeln.