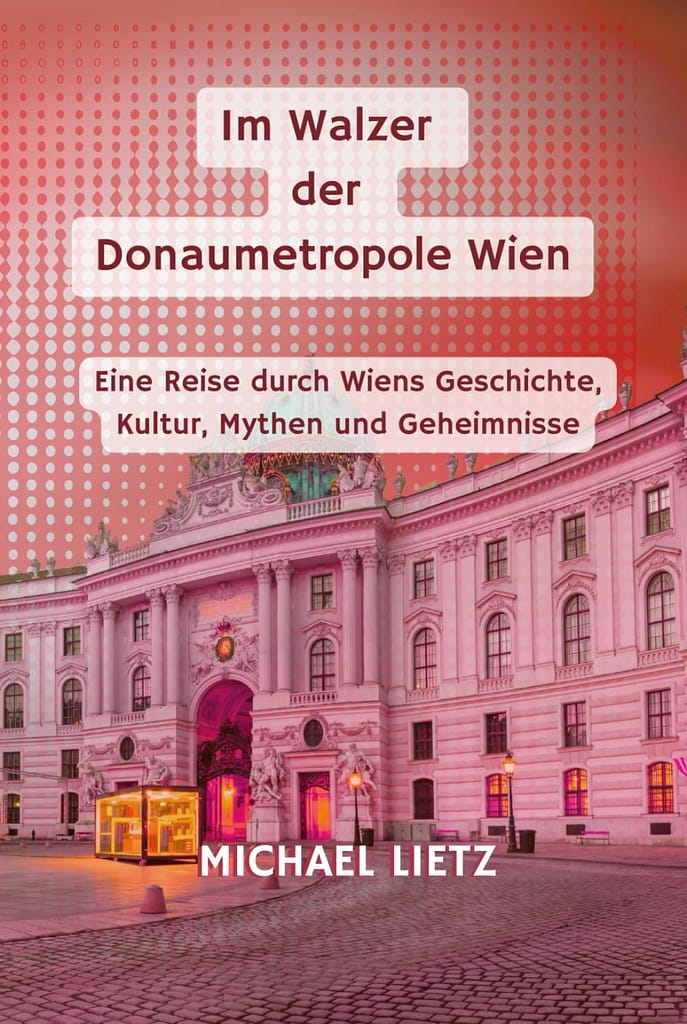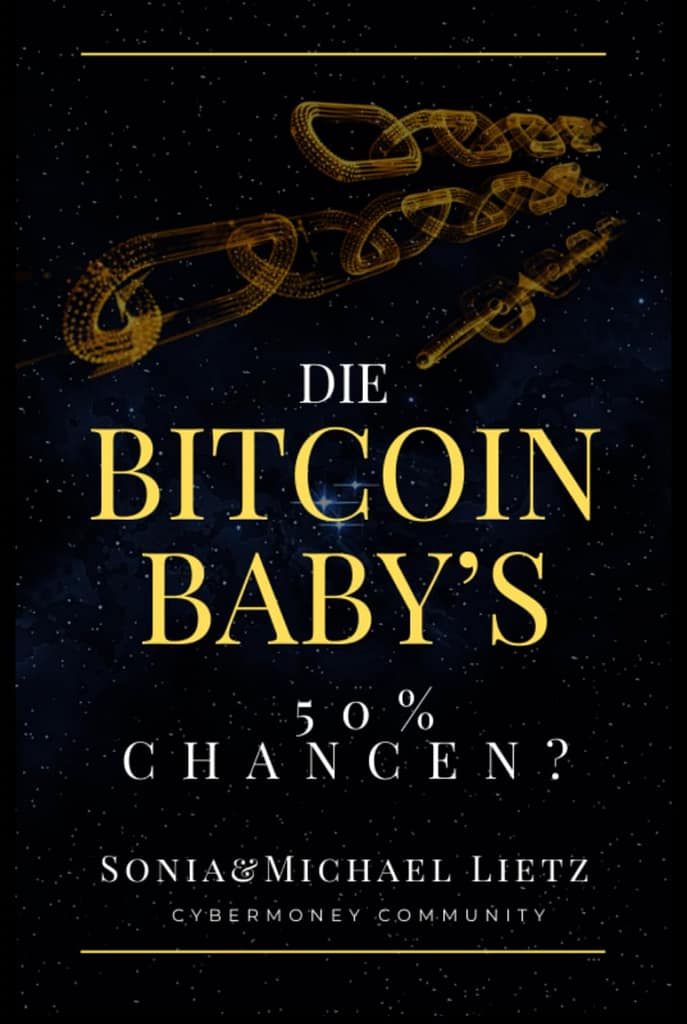Wenn die Herbstsonne tief über Wien steht und die Blätter der Kastanienbäume entlang der Simmeringer Hauptstraße in goldenem Glanz erstrahlen, öffnet sich ein Tor zu einer anderen Welt. Der Wiener Zentralfriedhof, weit draußen im 11. Bezirk, ist kein gewöhnlicher Ort des Abschieds. Er ist eine Metropole der Toten, ein Garten der Erinnerung, ein Spiegel der Wiener Seele, die den Tod mit einer eigentümlichen Mischung aus Ehrfurcht, Humor und Melancholie betrachtet. Mit seinen fast zweieinhalb Quadratkilometern, auf denen über drei Millionen Seelen ihre letzte Ruhe gefunden haben, ist er nicht nur Europas größter Friedhof nach Bestatteten, sondern auch ein Ort, der Geschichte, Kunst und Natur in einer einzigartigen Symbiose vereint. Wer hier entlang der stillen Alleen spaziert, hört das Rascheln der Blätter und spürt die Geschichten, die in den Steinen und Bäumen flüstern – Geschichten von Kaisern und Künstlern, von Revolutionen und stillen Triumphen.
Die Geschichte dieses Ortes beginnt in einer Zeit, als Wien sich aus den Fesseln des Mittelalters löste und in die Moderne strebte. Bereits im 18. Jahrhundert, unter den Reformen Kaiser Josephs II., wurden die innerstädtischen Friedhöfe aufgelassen, da sie den wachsenden Ansprüchen einer expandierenden Metropole nicht mehr genügten. Die sogenannten josephinischen Reformen verboten Begräbnisse innerhalb des Linienwalls, der dem heutigen Gürtel entsprach, und führten zur Schaffung neuer Friedhöfe in den Vororten. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts, als Wien unter der Industrialisierung zu einer Millionenstadt heranwuchs, reichten auch diese nicht mehr aus. Die fünf kommunalen Friedhöfe – St. Marx, Hundsturm, Matzleinsdorf, Währing und Schmelz – waren überlastet, und die Stadt träumte von einem Ort, der groß genug war, um die Toten einer Weltstadt für Jahrhunderte aufzunehmen. 1863 fasste der Gemeinderat den Beschluss, einen Zentralfriedhof zu errichten, weit draußen in Simmering, wo die Felder noch unberührt waren und die Bodenbeschaffenheit ideal schien. Die Architekten Karl Jonas Mylius und Alfred Friedrich Bluntschli aus Frankfurt gewannen den Wettbewerb für die Gestaltung, und nach nur drei Jahren Bauzeit wurde der Friedhof am 1. November 1874 eröffnet – still und ohne große Zeremonie, um Proteste der katholischen Bevölkerung zu vermeiden, die den interkonfessionellen Charakter des Ortes ablehnte.
Die Wiener waren zunächst skeptisch. Die lange Fahrt nach Simmering, damals noch weit außerhalb der Stadt, war mühsam, und die endlosen Leichenzüge, die sich über die Simmeringer Hauptstraße schleppten, trübten das Gemüt der Anwohner. Im Winter blieben die Pferdekarren oft im Schnee stecken, und die Idee, die Toten durch Tunnel wie in einer makabren Rohrpost zu befördern, wurde ernsthaft diskutiert, aber glücklicherweise verworfen. Erst die Einführung der elektrischen Straßenbahnlinie 71 im Jahr 1901, später liebevoll „Friedhofs-Express“ genannt, machte den Friedhof zugänglicher. Der „71er“ wurde zum Symbol für den letzten Weg eines Wieners, und noch heute sagt man von einem Verstorbenen: „Er hat den 71er genommen.“ Mit der Zeit gewann der Zentralfriedhof an Ansehen, vor allem, als die Stadt beschloss, die Gebeine berühmter Persönlichkeiten wie Ludwig van Beethoven und Franz Schubert aus den alten Vorortfriedhöfen hierher zu überführen. Diese Ehrengräber, ab 1881 angelegt, verwandelten den Friedhof in eine Pilgerstätte für Kunstliebhaber und machten ihn zu einer der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Wiens.
Wer durch das Tor 2, den Haupteingang, tritt, betritt eine Welt, die zugleich still und lebendig ist. Die weiten Alleen, gesäumt vom Efeu und umrankt von wilden Rosen, führen an prunkvollen Mausoleen und bescheidenen Grabsteinen vorbei, die von der bewegten Geschichte Wiens zeugen. In der Mitte des Friedhofs erhebt sich die majestätische Karl-Borromäus-Kirche, ein Jugendstiljuwel, entworfen von Max Hegele, das zwischen 1908 und 1910 erbaut wurde. Ihre Kuppel, die im Zweiten Weltkrieg durch eine Brandbombe zerstört und später wiederaufgebaut wurde, thront wie ein stiller Wächter über dem Gelände. Rund um die Kirche gruppieren sich die Ehrengräber, ein Who’s Who der österreichischen Kulturgeschichte. Hier ruht Johann Strauss, dessen Walzer die Stadt zum Tanzen brachten, neben Johannes Brahms, dessen Symphonien die Herzen der Wiener eroberten.
Das Buch das Dir Wien vorstellt und du verstehst warum du Wien einfach lieben musst:
Hol dir den echten Wiener Lesegenuss und lass dich verzaubern – klick auf das Cover
Franz Schubert und Ludwig van Beethoven, deren Musik die Seele Wiens prägte, haben hier ihre letzte Ruhe gefunden, ebenso wie Christoph Willibald Gluck und Hugo Wolf. Doch das meistbesuchte Grab gehört Hans Hölzel, besser bekannt als Falco, dem Popstar, der mit „Rock Me Amadeus“ die Welt eroberte. Sein Grab, gekrönt von einem drei Meter hohen Obelisken und einer Glasplatte mit seinem Konterfei, ist eine Pilgerstätte für Fans, die noch immer um den viel zu früh Verstorbenen trauern. Auch die Präsidentengruft, die die sterblichen Überreste österreichischer Staatsoberhäupter birgt, und die Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus zeugen von der tiefen historischen Verwurzelung dieses Ortes.
Der Zentralfriedhof ist mehr als eine letzte Ruhestätte. Er ist ein interkonfessioneller Ort, der Menschen aller Glaubensrichtungen vereint. Neben dem katholischen Hauptfriedhof gibt es Abteilungen für Juden, Muslime, Buddhisten, orthodoxe Christen und Protestanten, die das kulturelle Mosaik Wiens widerspiegeln. Der alte jüdische Friedhof am Tor 1, mit seinen verwitterten, von Efeu umrankten Grabsteinen, ist eine wildromantische Oase, die an die blühende jüdische Gemeinde Wiens vor dem Holocaust erinnert. Doch die Geschichte dieses Ortes ist auch von Schmerz geprägt: Während der NS-Zeit wurden jüdische Friedhöfe enteignet, und viele Gräber blieben unbewacht, da ganze Familien ausgelöscht wurden. Heute werden diese Bereiche von der Israelitischen Kultusgemeinde gepflegt, ein Akt der Erinnerung und Versöhnung.
Neben seiner historischen und kulturellen Bedeutung ist der Zentralfriedhof ein Paradies für die Lebenden. Seine weit personally, mit Rehen, Feldhamstern und Eichhörnchen bevölkerte Parklandschaft lädt zu Spaziergängen ein, die ebenso besinnlich wie belebend sind. Jogger und Radfahrer nutzen die Alleen, und selbst Bienen fühlen sich hier wohl – ihr „Friedhofshonig“ ist ein besonderes Souvenir. Die Nachtführungen, die von Oktober bis März angeboten werden, tauchen den Friedhof in eine schaurige Atmosphäre, während Fiakerfahrten eine nostalgische Reise durch die Geschichte ermöglichen. Der Friedhof ist auch ein Ort der Innovation: Mit Waldgräbern und nachhaltigen Bestattungsformen wie dem „lebenden Sarg“ aus Pilzen setzt er Maßstäbe in der modernen Bestattungskultur. Ein Solarkraftwerk versorgt die elektrischen Busse, die Besucher über das riesige Gelände chauffieren, und macht den Friedhof zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit.
Die Wiener haben eine besondere Beziehung zum Tod, geprägt von einem Hang zum Morbiden, der in Liedern wie Wolfgang Ambros’ „Es lebe der Zentralfriedhof“ oder Georg Kreislers „Der Tod, das muss ein Wiener sein“ seinen Ausdruck findet. Der Friedhof ist ein Ort, an dem man nicht nur trauert, sondern auch das Leben feiert. „In Wien musst’ erst sterben, bevor sie dich hochleben lassen“, sagte Falco einst, und nirgendwo spürt man dies so deutlich wie hier. Der Zentralfriedhof ist ein Spiegel der Wiener Seele – ein Ort, an dem die Vergänglichkeit des Lebens in jeder Allee, jedem Grabstein und jedem Rascheln im Gebüsch spürbar ist. Wer ihn besucht, nimmt nicht nur die Geschichten der Verstorbenen mit, sondern auch ein Stück der Stadt, die den Tod nicht fürchtet, sondern ihn umarmt, als wäre er ein alter Freund. Hier, wo die Echos der Ewigkeit flüstern, wird der Tod zu einem Wiener – und Wien zu einem Ort, der für immer im Herzen bleibt.